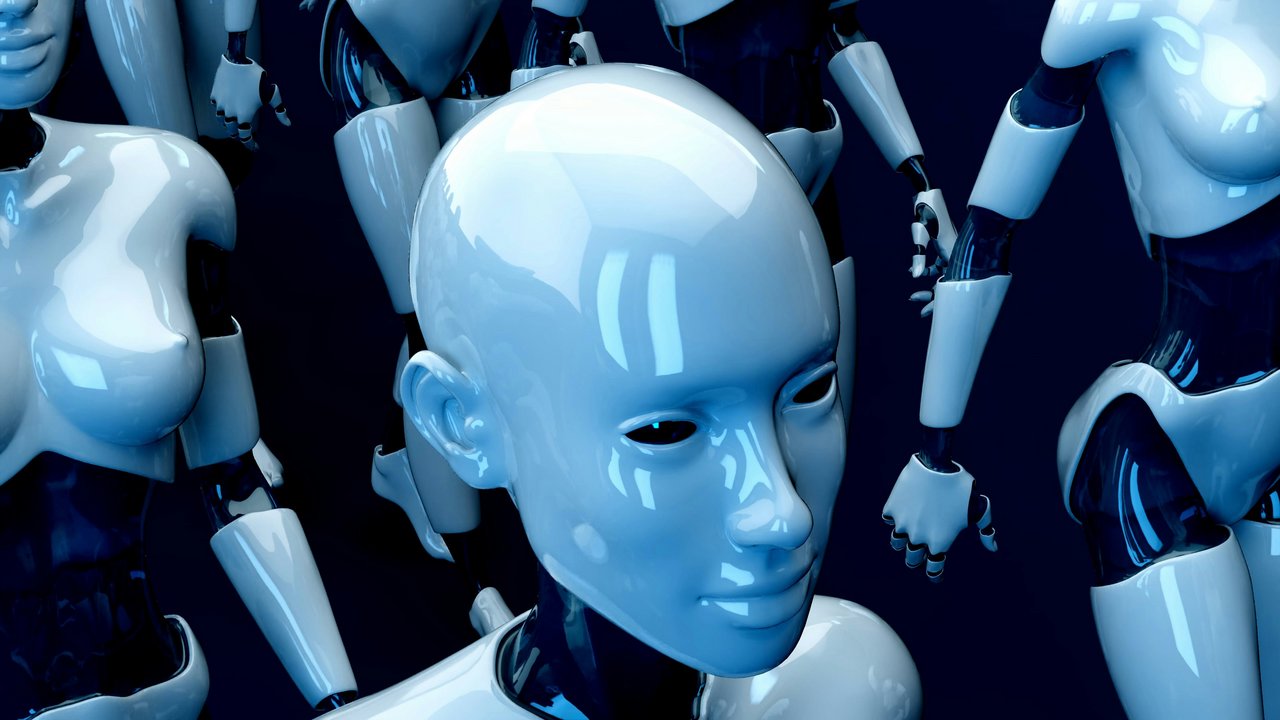„Agenten“ gehören zu den schillernden Begriffen der aktuellen KI-Debatte. Kaum eine Produktankündigung, die ohne sie auskommt. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stößt schnell auf große Versprechen: Agenten sollen komplexe Aufgaben selbstständig erledigen, ganze Arbeitsprozesse automatisieren und so fast wie digitale Mitarbeiter wirken. Doch was genau steckt hinter dem Begriff? Und vor allem: Was bedeutet das für Unternehmen, die sich fragen, wie sie diese Technologie sinnvoll einsetzen können? Um das zu verstehen, lohnt ein Blick zurück.
Von den 90ern bis heute: Was ein „Agent“ ursprünglich war
Der Gedanke eines „Agenten“ ist älter, als man vielleicht vermutet. Bereits in den 1990er-Jahren sprach man in der Informatik von Software-Agenten. Gemeint waren Programme, die selbstständig kleine Aufgaben übernahmen.
Ein klassisches Beispiel ist der Suchagent: Ein Programm, das regelmäßig bestimmte Webseiten nach neuen Inhalten durchforstete und den Nutzer über Veränderungen informierte. Oder Handelsbots, die im Aktienmarkt bestimmte Kursbewegungen erkannten und automatisch darauf reagierten. Diese Agenten hatten drei zentrale Eigenschaften: Sie handelten eigenständig in einem festgelegten Rahmen, sie konnten auf ihre Umgebung reagieren, und sie arbeiteten oft unsichtbar im Hintergrund.
Allerdings blieb ihre Intelligenz begrenzt. Sie folgten klaren, vordefinierten Regeln – wenn-dann-Strukturen, die wenig Raum für Flexibilität ließen. Trotzdem war schon damals die Idee da: Ein Agent soll dem Menschen Arbeit abnehmen, indem er Aufgaben übernimmt, die sonst mühsam manuell erledigt werden müssten.
Heute: KI-Agenten als smarte Assistenten
Mit dem Aufkommen großer Sprachmodelle hat sich das Bild verschoben. Wenn heute von KI-Agenten die Rede ist, geht es meist nicht mehr um kleine Programme mit starren Regeln, sondern um Systeme, die ein Sprachmodell als „Gehirn“ nutzen.
Ein solcher Agent kann zum Beispiel eine Anfrage entgegennehmen, eigenständig eine Datenbank durchsuchen, die Ergebnisse zusammenfassen und diese in Form einer E-Mail verschicken. Auf den ersten Blick wirkt das sehr autonom. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich: Auch diese Agenten bewegen sich in relativ engen Bahnen.
Das Sprachmodell sorgt zwar für Flexibilität im Detail – es kann Formulierungen variieren, auf unvorhergesehene Situationen reagieren oder Informationen in natürlicher Sprache verarbeiten. Aber die großen Linien sind immer noch vorgegeben. Das Ziel und die verfügbaren Tools sind festgelegt; einzelne Schritte plant und revidiert der Agent zunehmend selbst.
Das führt zu einer interessanten Diskrepanz: Während der Begriff „Agent“ historisch für Autonomie stand, sind heutige KI-Agenten in Wirklichkeit eher spezialisierte Assistenten. Sie können Aufgaben sehr effizient ausführen, aber sie sind keine freien Problemlöser, die sich völlig neue Strategien ausdenken.
Was KI-Agenten heute leisten können
Auch wenn der Autonomiegrad begrenzt ist, sind die praktischen Einsatzmöglichkeiten beeindruckend. In vielen Unternehmen entstehen bereits konkrete Anwendungsfälle, die Prozesse spürbar beschleunigen und Mitarbeiter entlasten.
Ein Beispiel aus dem Marketing: Ein Agent kann Kampagnendaten aus verschiedenen Quellen zusammenziehen, erste Auswertungen vornehmen und daraus einen Rohentwurf für eine Präsentation erstellen. Der Marketingmanager spart damit Stunden an Vorarbeit und kann sich auf die Interpretation und strategische Ableitung konzentrieren. Noch stärker wird der Nutzen, wenn der Agent nicht nur Zahlen zusammenträgt, sondern auch gleich Vorschläge für Hypothesen formuliert – etwa, warum eine bestimmte Kampagne in einer Zielgruppe besonders gut funktioniert hat.
Ähnlich im Kundenservice: Agenten können eingehende Anfragen analysieren, passende Antworten vorschlagen und Tickets vorkategorisieren. Die endgültige Antwort geht weiterhin durch die Hände eines Servicemitarbeiters, doch der Vorbereitungsaufwand sinkt drastisch. In einer Versicherung zum Beispiel könnte ein Agent automatisch Schadensmeldungen vorsortieren und relevante Dokumente anhängen, sodass die Sachbearbeiter direkt mit der Bearbeitung beginnen können.
Auch in der Business-Analyse entfalten Agenten ihr Potenzial. Statt mühsam Excel-Sheets zusammenzuführen, lassen sich Daten aus unterschiedlichen Systemen automatisch konsolidieren. Der Agent liefert einen strukturierten Report, den Controller oder Analysten nur noch prüfen und ergänzen müssen. Für Unternehmen mit vielen Filialen oder Standorten bedeutet das: Die Monatsreports liegen schneller und konsistenter vor – ein Vorteil, der unmittelbar spürbar wird.
Im E-Commerce wiederum können Agenten helfen, Produktinformationen aus verschiedenen Quellen abzugleichen. Ein Händler, der tausende Artikel pflegt, kann einen Agenten einsetzen, um Inkonsistenzen zwischen PIM-System, Shop und Lagerbestand zu identifizieren. So wird verhindert, dass Produkte mit veralteten Informationen im Online-Shop erscheinen oder Kunden falsche Lieferzeiten angezeigt bekommen.
Und selbst in der Software-Entwicklung werden Agenten erprobt: Sie analysieren Fehlerberichte, schlagen mögliche Ursachen vor und generieren sogar erste Code-Snippets, die Entwickler als Basis für ihre Arbeit nutzen können. Denkbar ist zum Beispiel, dass ein Agent wiederkehrende Bugs automatisch erkennt und eine „Sofortmaßnahme“ vorschlägt, während das Entwicklerteam an der langfristigen Lösung arbeitet.
Von der Idee zur Praxis: Technische Anforderungen und Kosten
Bevor ein Agent seine Arbeit aufnehmen kann, müssen grundlegende technische Voraussetzungen geschaffen werden. Im Gegensatz zur einfachen Nutzung eines Chatbots, der in der Cloud läuft, erfordern Agenten, die auf Unternehmensdaten zugreifen, eine sichere Integration in die bestehende IT-Infrastruktur.
Sie benötigen Programmierschnittstellen (APIs), um mit Systemen wie CRM, ERP oder Datenbanken zu kommunizieren. Die Herausforderung liegt darin, diese Schnittstellen so einzurichten, dass sie effizient und gleichzeitig sicher funktionieren. Fehler in der Konfiguration können nicht nur Prozesse stören, sondern auch Sicherheitsrisiken erzeugen. Praxisnah sind Least-Privilege-Zugriffe, Audit-Logs und Freigabeschwellen für kritische Aktionen.
Ein weiterer Knackpunkt ist die Datenqualität: Ein Agent liefert nur so gute Ergebnisse wie die Daten, auf die er zugreift. Widersprüchliche oder unvollständige Stammdaten - etwa doppelte Kundenadressen oder alte Postleitzahlen - führen direkt zu fehlerhaften Resultaten. Unternehmen müssen daher oft zuerst in Datenkonsolidierung und -bereinigung investieren, bevor Agenten zuverlässig arbeiten können.
Hinzu kommt: Je komplexer ein Business-Use-Case ist, desto anspruchsvoller wird das Design der Agenten selbst. Es reicht nicht, einfach ein Sprachmodell an Unternehmensdaten anzubinden - entscheidend ist, die Prozesse, Regeln und Abhängigkeiten der jeweiligen Fachdomäne zu verstehen. Hier braucht es die Erfahrung von Experten, die Business-Anforderungen präzise übersetzen können. Nur so entsteht eine Agenten-Struktur, die nicht nur technisch funktioniert, sondern auch den tatsächlichen Mehrwert für das Unternehmen liefert.
Auch die Kosten sollten realistisch eingeschätzt werden. Sie lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen:
- Lizenzgebühren, etwa für Sprachmodelle oder spezialisierte Plattformen, die häufig nutzungsabhängig berechnet werden.
- Entwicklungs- und Integrationskosten, die bei der erstmaligen Anbindung an interne Systeme und der Erstellung von Workflows entstehen.
- Wartungs- und Betriebskosten, um Agenten laufend zu überwachen, anzupassen und auf neue Anforderungen zu reagieren.
Obwohl diese Investitionen zunächst beträchtlich erscheinen, hängt der ROI von Datenqualität, Prozessreife und Change-Management ab und wird über Kennzahlen wie Durchlaufzeiten und Fehlerquoten messbar. Denn wenn zeitintensive Routineaufgaben automatisiert werden, können Mitarbeiter ihre Zeit auf wertschöpfende Tätigkeiten verlagern. Gleichzeitig sinkt die Fehlerquote, was die Effizienz zusätzlich steigert.
Human-in-the-loop: Warum der Mensch unverzichtbar bleibt
So beeindruckend die Möglichkeiten von Agenten sind, eines wird deutlich: Wirklich autonom arbeiten die Systeme nicht – und das ist auch gut so.
Gerade in unternehmenskritischen Kontexten bleibt der Mensch unverzichtbar. Agenten können Daten sammeln, ordnen und vorschlagen – doch die entscheidende Kontrolle muss weiterhin durch Menschen erfolgen. Diese Rolle wird oft als Human-in-the-loop beschrieben.
Das Konzept bedeutet: Der Mensch bleibt Teil des Prozesses, insbesondere an den Schnittstellen, an denen Qualität, Verantwortung oder strategische Relevanz auf dem Spiel stehen. Der Agent entlastet, beschleunigt und strukturiert – aber die letzte Entscheidung trifft ein Mensch.
Wie wichtig diese Rolle ist, haben wir im ontolux-Blog am Beispiel der Forschung gezeigt: Dort hat ein KI-Agent ein vollständiges wissenschaftliches Manuskript erstellt – und dieses wurde sogar im Peer Review akzeptiert. Auf den ersten Blick ein beeindruckendes Ergebnis, das die Leistungsfähigkeit solcher Systeme unterstreicht. Doch gerade weil ein formal korrekt wirkender Text den Review-Prozess bestehen konnte, zeigt sich: Ohne menschliche Kontrolle droht Substanzlosigkeit hinter scheinbarer Perfektion. Wer Qualität und Relevanz sicherstellen will, braucht weiterhin Menschen im Prozess.
In der Praxis bedeutet das: Ein Agent entwirft ein Mailing, doch bevor es verschickt wird, prüft ein Mitarbeiter Tonalität und Fakten. Oder ein Agent erstellt einen Finanzreport, aber der Controller gleicht die Zahlen ab und stellt sicher, dass keine fehlerhaften Interpretationen enthalten sind.
Jenseits der Technik: Ethische und rechtliche Hürden
Neben technischen Fragen stellen KI-Agenten Unternehmen vor rechtliche und ethische Herausforderungen. Zentral ist die Verantwortung: Wer haftet, wenn ein Agent fehlerhafte Entscheidungen trifft? EU-Vorgaben zu Aufsichtspflichten und Produkthaftung schaffen hier erste Klarheit.
Ein weiteres zentrales Thema ist der Datenschutz. Agenten benötigen oft Zugriff auf eine Vielzahl interner Systeme – von Kundendatenbanken bis hin zu Mitarbeiterinformationen. Dies erhöht das Risiko von Datenlecks und Missbrauch. Unternehmen müssen definieren, welche Daten ein Agent verarbeiten darf und wie diese Interaktionen protokolliert werden.
Schließlich stellen sich ethische Fragen: Agenten können Vorurteile aus Trainingsdaten reproduzieren oder im Kundenkontakt Empathie vermissen lassen. Deshalb bleibt Human-in-the-loop nicht nur eine Qualitätskontrolle, sondern auch ein ethischer Filter, der sicherstellt, dass Entscheidungen mit den Werten des Unternehmens vereinbar sind.
Ausblick: Vom Assistenten zum Agenten
Wenn man den Blick in die Zukunft richtet, lässt sich eine Entwicklung abzeichnen. Heute sind KI-Agenten spezialisierte Helfer, die in engen Bahnen arbeiten. In den nächsten Jahren könnten sie jedoch zunehmend eigenständiger werden.
Vorstellbar sind Systeme, die nicht nur Teilaufgaben übernehmen, sondern ganze Projekte steuern – inklusive Priorisierung, Abstimmung mit anderen Agenten und dynamischer Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. In diesem Szenario entsteht eine Art digitales Ökosystem, in dem Agenten miteinander kooperieren, Informationen austauschen und sogar in Konkurrenz treten.
Ein mögliches Bild für den Unternehmensalltag in fünf bis zehn Jahren: Morgens loggt sich ein Mitarbeiter ins Dashboard ein und sieht, welche Aufgaben „seine“ Agenten bereits erledigt haben – ein Marketing-Agent hat die Social-Media-Performance analysiert, ein Finanz-Agent hat Abweichungen im Monatsreport markiert, ein IT-Agent hat ein Sicherheitsupdate angestoßen. Der Mitarbeiter entscheidet, welche Ergebnisse übernommen, welche verworfen und welche nachjustiert werden. Agenten werden so zu ständigen Teammitgliedern, die nicht müde werden, Routinearbeit zu erledigen – während Menschen den Rahmen setzen und strategisch gestalten.
Fazit
KI-Agenten sind heute keine autonomen Alleskönner – aber sie markieren einen entscheidenden Schritt in der Automatisierung von Wissensarbeit. Sie übernehmen Vorarbeiten, strukturieren Informationen und schaffen Freiräume für Menschen, sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren.
Für Unternehmen bedeutet das: Wer jetzt beginnt, mit Agenten zu experimentieren, kann Effizienzgewinne realisieren und gleichzeitig lernen, wie sich Mensch und Maschine sinnvoll ergänzen. Entscheidend bleibt dabei das Prinzip Human-in-the-loop: Der Mensch steuert, prüft und entscheidet.
So verstanden sind KI-Agenten kein Hype, sondern ein Werkzeug, das schon heute echten Mehrwert liefert – und gleichzeitig den Weg in eine Zukunft weist, in der digitale Assistenten vielleicht tatsächlich zu autonomen Kollegen werden.
Datum: 10.09.2025
Bildquelle: Foto von julien Tromeur auf Unsplash
Sprechen Sie uns an

Andreas Nehls
Andreas unterstützt die Neofonie Gruppe seit März 2024 als Account Manager. Aus den Gesprächen mit aktuellen und potenziellen Kunden sowie Veranstaltungen rund um die Themen KI, Digitalisierung, Projektmanagement und Innovation ergeben sich immer wieder spannende Themen, über die er hier schreibt. Dabei liegt der Fokus weniger auf technischen Details, sondern vielmehr auf den geschäftlichen, rechtlichen und regulatorischen Aspekten.